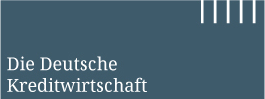
Pfändungsschutz von Hilfsgeldern im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie sowie der Energiepauschale i. H. v. 300 Euro
Corona-Hilfsgelder
Nach Auffassung der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) unterliegen Soforthilfezahlungen, die im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie gewährt und einem Konto gutgeschrieben werden, der Zwangsvollstreckung in das Kontoguthaben (vgl. hierzu DK-Stellungnahme vom 14. April 2020). Dies gilt für alle Girokonten unabhängig davon, ob sie als Pfändungsschutzkonten geführt werden. Hilfsgeldzahlungen müssen daher an den Pfändungsgläubiger ausgekehrt werden, bzw. bei Pfändungsschutzkonten insoweit ausgekehrt werden, wie sie über dem individuellen kalendermonatlichen Freibetrag des Schuldners liegen. Sie sind nicht anders zu behandeln als andere Kontogutschriften. Das gilt unabhängig davon, ob die Soforthilfezahlung ihrerseits pfändbar ist oder nicht. Letzteres war bislang umstritten und ein Gesetzesentwurf, der die Unpfändbarkeit von Hilfsgeldern anordnen sollte, wurde bislang nicht eingebracht.
Mittlerweile liegen höchstrichterliche Entscheidungen vor, die dem Schuldner Möglichkeiten eröffnen, wie er sich das Guthaben aus einer Soforthilfezahlung auf seinem Girokonto auch im Falle einer Kontopfändung erhalten kann.
So hat der Bundesgerichtshof in einem am 7. April 2021 veröffentlichten Beschluss die Frage entschieden, ob eine auf ein Pfändungsschutzkonto eingezahlte Corona-Soforthilfe pfändbar ist (Beschl. v. 10.03.2021, Az. VII ZB 24/20). Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs handelt es sich bei der Corona-Soforthilfe um eine nach § 851 ZPO unpfändbare Forderung. Um dem Schuldner das Guthaben aus der Soforthilfe auch auf seinem Konto zu erhalten, muss dieser in entsprechender Anwendung von § 850k Abs. 4 ZPO a. F. (jetzt: § 906 Abs. 2 ZPO) einen Antrag auf Erhöhung des Pfändungsfreibetrages beim Vollstreckungsgericht stellen.
Ähnlich hatte bereits zuvor der Bundesfinanzhof entschieden (Beschluss vom 9. Juli 2020, Az. VII S 23/20).
Dies gilt jedoch nach der Rechtsprechung des BGH nicht für Corona Überbrückungshilfen für Unternehmen (Beschluss vom 16.08.2023 zu AZ: VII ZB 64/21).
Danach handelt es sich zwar auch bei erhaltenen Corona Überbrückungshilfen III für Unternehmen (Billigkeitsleistung des Bundes in Form einer Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe) um eine nach § 851 ZPO i.V.m. § 399 1. Alt BGB unpfändbare Forderung., da sie als zweckgebunden einzustufen ist. Jedoch erstreckt sich dieser Forderungspfändungsschutz nicht auf bereits überwiesene Gelder. Die Unpfändbarkeit endet mit Überweisung auf das Konto des Unternehmens. Eine juristische Person kann sich insoweit nicht auf eine entsprechende Anwendung der für ein Pfändungsschutzkonto gemäß § 850 k ZPO bei natürlichen Personen geltenden Schutzvorschriften nach §§ 906 Abs.1 Nr. 6 i.V.m. 906 Abs. 2 berufen; ihm steht lediglich im Einzelfall bei einer gegen die guten Sitten verstoßenden unzumutbaren Härte Vollstreckungsschutz gemäß § 765 a ZPO zu.
Energiepauschale
Die gleiche rechtliche Bewertung wie bei den Corona-Hilfsgeldern gilt wohl auch für die im Herbst 2022 bezahlte Energiepauschale i. H. v. 300 Euro. D. h., auch hier muss der Schuldner einen Antrag auf Erhöhung des Pfändungsfreibetrages beim Vollstreckungsgericht stellen, damit ihm das Guthaben aus der Energiepauschale auf seinem Konto erhalten bleibt. Hier steht allerdings eine Bestätigung durch die Rechtsprechung noch aus.


